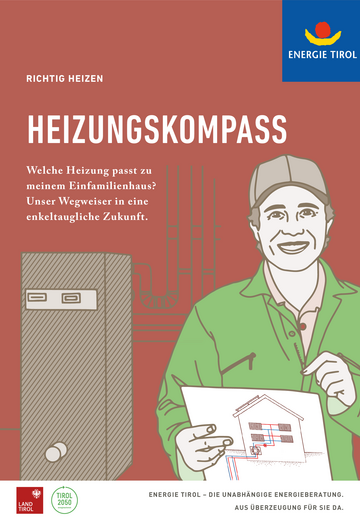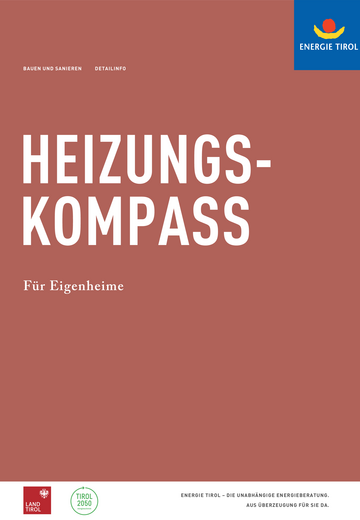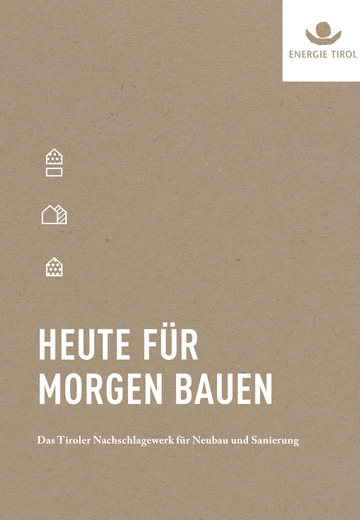Funktionsweise
Infrarotheizungen sind elektrische Widerstandsheizungen. Das heißt, sie wandeln Strom in Wärme um und geben diese in der Folge an den Raum ab.
Wärmeabgabe kann grundsätzlich über Wärmeleitung (Wärmefluss in einem Feststoff in Richtung der geringeren Temperatur), Wärmestrahlung (Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen) und Konvektion (Erwärmung der vorbeiströmenden Luft) erfolgen.
Bei der Infrarotheizung resultiert die Wärmeabgabe überwiegend aus Strahlung. Konventionelle Heizkörper (Radiatoren) haben, abhängig von ihrer Kompaktheit, einen Strahlungsanteil von 20 bis 40 Prozent. Infrarotheizungen können ebenso wie Fußboden- und Wandheizungen einen Strahlungsanteil von bis zu 60 Prozent erreichen. Die restliche Wärmeabgabe erfolgt über Konvektion und Wärmeleitung. Eine hundertprozentige Wärmeabgabe über Wärmestrahlung ist physikalisch nicht möglich. Eine Eigenheit von Heizsystemen mit hohem Strahlungsanteil (ab 50 Prozent) ist ihre Fähigkeit, Umfassungsbauteile wie Böden, Wände oder Decken sowie Möbel zu erwärmen. Dies wird von den meisten Menschen als besonders behaglich empfunden und gleicht der Wärme eines Kachelofens. Dadurch kann die Raumtemperatur – im Vergleich zu mit Radiatoren beheizten Räumen – um ca. 1-2 °C abgesenkt werden, ohne Einbußen bei der Behaglichkeit erwarten zu müssen. Ein ähnlicher Effekt tritt auch bei Flächenheizungen, wie Fußboden- und Wandheizungen auf.
Um die erforderliche Leistung an den Raum abgeben zu können, erwärmen sich Infrarotpaneele auf bis zu 100 °C.
Einsatzbereiche
Neubau
Elektrische Widerstandsheizungen, und somit auch Infrarotheizungen, sind laut OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2015, im Neubau nur unter Einhaltung von energietechnischen Mindestanforderungen (Heizwärmebedarf HWBREF,RK, Endenergiebedarf E/LEBRK, Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE - siehe Glossar) zugelassen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Anforderungen nur in Niedrigstenergiegebäuden mit zusätzlichen Effizienzmaßnahmen (z.B. Errichtung einer PV-Anlage, Komfortlüftung oder Solaranlage zur Warmwasserbereitung) umsetzbar sind. Planungs- und Rechtssicherheit bringt hierbei nur der Nachweis über den Energieausweis.
Wir bewerten den Einbau einer Infrarotheizung im Neubau einzig bei Passivhausgebäuden als sinnvoll. Hier stehen die Kosten für Heizraum und Verteilung bei wassergeführten Systemen in einem ungünstigen Verhältnis zur benötigten Wärmemenge, sodass der Einsatz einer Infrarotheizung durchaus sinnvoll sein kann.
Im mehrgeschossigen Wohnbau fordert die OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2015, eine zentrale Wärmeerzeugung, was den Anwendungsbereich von Infrarotheizungen hier ausschließt. Ausgenommen davon sind Niedrigstenergiegebäude, die einen Referenz-Heizwärmebedarf (siehe Glossar) von < 25 kWh/m²a aufweisen.
Zusätzlich ist laut Tiroler Bauordnung im Neubau auch eine technische, ökologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit des Einsatzes von hocheffizienten alternativen Systemen zu prüfen. Diese sind bei positiver Prüfung auch einzusetzen. Zu alternativen Systemen zählen Heizanlagen auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen, Wärmepumpen, Nah- und Fernwärme sowie die Kraftwärmekopplung.
Auch für den geplanten Einbau einer Infrarotheizung ist eine solche Alternativenprüfung durchzuführen. Die Energieagentur Tirol stellt dazu hier ein Excel-Tool als Umsetzungshilfe zur Verfügung.
Sanierung & Heizungstausch
Wenn das Gebäude bisher über eine Stromdirektheizung (z.B. Nachtspeicheröfen) beheizt wurde, ist es aufwendig und kostenintensiv, nachträglich ein zentrales Heizsystem zu installieren. Systemkomponenten könnten nicht weiterverwendet werden und Verteilleitungen und Abgabesysteme müssten neu installiert werden. Zudem müssten Aufstellungsorte für den Wärmeerzeuger und gegebenenfalls für die Brennstofflagerung gefunden werden. In diesem Fall kann es durchaus ökonomisch sinnvoll sein, eine Infrarotheizung zu installieren.
Wenn das Gebäude bereits über ein zentrales Heizsystem (Biomasseheizung, Fernwärme, Öl, Gas etc.) verfügt, ist zu prüfen, ob Systemkomponenten übernommen werden können. Meist kann die Heizung durch den Austausch der defekten oder veralteten Komponenten weiter in Verwendung bleiben. Ist beispielsweise nur der Wärmeerzeuger nicht mehr funktionsfähig, das Verteilnetz aber noch intakt, sollte im Regelfall ein Kesselaustausch (z.B. Pelletskessel oder Wärmepumpe) geprüft werden. Sollte die Wahl trotzdem auf eine elektrische Widerstandsheizung fallen, ist von einem befugten Unternehmen zu prüfen, ob die Anschlussleistung, das Netzbezugsrecht und die Absicherung der Stromkreise ausreichend ist.
Grundsätzlich sollten aber immer auch die Auswirkungen auf künftige, behördlich bewilligungspflichtige Bauvorhaben beachtet werden. Denn, wie beim Neubau sind auch bei umfassenden Sanierungen, Wohnungsteilungen oder -vereinigungen laut Tiroler Bauordnung energietechnische Grenzwerte einzuhalten: Heizwärmebedarf (HWBREF,RK), Endenergiebedarf (E/LEBRK), Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE). Mit Infrarotheizungen können diese häufig nicht mehr erreicht werden, was sich negativ auf künftige Bescheide, aber auch auf Förderungen der öffentlichen Hand auswirken kann.
Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen
Vorteile
- Geringe Investitionskosten
- Schnelle Installation
- Keine Wartung und Instandhaltung
- Kein Kamin oder Lagerraum erforderlich
- Hoher Wirkungsgrad und keine signifikanten Verteilverluste innerhalb des Gebäudes
Nachteile
- Betriebskosten sind in der Regel deutlich höher, als bei Systemen mit zentralen Wärmeerzeugern
- Einsatz der hochwertigen Energieform Strom zur Bereitstellung von 20 °C Raumwärme
- Verluste bei Erzeugung, Speicherung und Transport der elektrischen Energie
- Hoher CO2-Fußabdruck (gemäß OIB-Richtlinie 6)
- Eigenes System zur Brauchwasserbereitung erforderlich
- Hohe Temperatur der Platten – Verbrennungsrisiko
Kombination
mit einer PV-Anlage
PV und elektrische Widerstandsheizung
Die Kombination einer Infrarotheizung mit einer PV-Anlage ist grundsätzlich möglich. Allerdings kann nur ein kleiner Anteil des selbst produzierten Stroms direkt mit der Infrarotheizung in Wärme umgewandelt werden. Dies liegt daran, dass im Winter, wenn die Heizung benötigt wird (und somit der Strombedarf hierfür am größten ist), das solare Angebot am geringsten ist. Im Gegensatz dazu wird im Sommer mit der PV-Anlage ein Überschuss erzeugt, der dann in das öffentliche Netz eingespeist wird. Eine saisonale Speicherung vor Ort als Vorrat für den Winter ist nicht möglich. Die Energiebilanz über das ganze Jahr kann zwar ausgeglichen sein, der überschüssige Strom im Sommer muss allerdings ins öffentliche Netz eingespeist und bei Bedarf zu einem höheren Preis wieder zugekauft werden. Batteriespeicher können das Problem zwar entschärfen und den Eigenverbrauchsanteil erhöhen, sind im Moment aber noch sehr kostenintensiv. Die Deckung des Strombedarfs für eine elektrische Widerstandsheizung sollte daher nicht die Hauptmotivation für die Errichtung einer PV-Anlage sein.
PV und Wärmepumpe
Die Kombination einer PV-Anlage mit einer Wärmepumpe für Warmwasser und Heizung ist einer elektrischen Widerstandsheizung mit PV-Anlage vorzuziehen. Trotz der thermischen Verluste im wassergeführten Verteilsystem ist die Wärmepumpe durch ihr Wirkprinzip, aus einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowattstunden Wärmeenergie zu erzeugen, grundsätzlich effizienter. Darüber hinaus wird durch die Kombination einer PV-Anlage mit einer Wärmepumpe der solare Ertrag multipliziert. Die Ansteuerung der Wärmepumpe mittels einfacher Zeitfunktion oder über eine intelligente Schnittstelle (beispielsweise ein „SG Ready“-Schnittstelle) hilft den Eigenverbrauch des Sonnenstroms weiter zu erhöhen. Jedoch kann auch bei dieser Systemkombination keine Volldeckung des Strombedarfs für die Wärmepumpe im Winterhalbjahr erreicht werden.
Empfehlungen zum Einsatz elektrischer Widerstandsheizungen
- Infrarotheizungen sollten bei Sanierungen nur in Einzelfällen und allenfalls zur Beheizung einzelner, untergeordneter Räume (z.B. Bad, Hobbyraum) eingesetzt werden
- Im Neubau beschränkt sich der Einsatz auf das Passivhaus
Diesen Empfehlungen liegen neben den technischen Voraussetzungen folgende Ansätze zu Grunde:
- Elektrischer Strom ist die hochwertigste Energieform und wird idealerweise nur Zwecken zugeführt, die dieses hohe Niveau erfordern. Beispielsweise gibt es keine sinnvollen Alternativen zum Einsatz von Strom für die Beleuchtung. Auch in der Industrie sind die meisten Prozesse ohne Strom nicht durchführbar.
- Wärme zur Beheizung von Räumen muss nicht unbedingt aus der hochwertigen Energieform Strom, sondern kann aus anderen, beispielsweise nachwachsenden Energieträgern, bereitgestellt werden. Die Verwendung von Wärmepumpensystemen mit hohen Jahresarbeitszahlen ist ein möglicher ökologischer und ökonomischer Mittelweg.
- Bei der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom entstehen gemäß OIB-Richtlinie 6, Stand 2015, ca. 276 Gramm CO2. Der in der OIB-Richtlinie 6 festgelegte CO2-Emissionswert für elektrische Energie ist ein Mittelwert, gebildet aus inländischer Erzeugung sowie Import und Export aus den vergangenen Jahren. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Österreich und insbesondere Tirol einen sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energieträgern in der Stromversorgung aufweisen. Wasserkraft, Wind und Sonne leisten schon heute einen erheblichen Beitrag zur Deckung unseres Strombedarfs. Ihr Anteil muss in Zukunft aber jedenfalls noch gesteigert werden. Konsument*innen können die Energiewende unterstützen, indem sie bei der Wahl der Stromversorgung auf Angebote mit hohem Ökostrom-Anteil setzen.
Information
und Beratung
Weitere Informationen zum Thema Heizung finden Sie in unserer Wissensbibliothek.
Sollten noch Fragen offen sein, stehen Ihnen unsere Expert*innen gerne zur Verfügung. Wir bieten allen Bauleuten eine produkt- und firmenneutrale Energieberatung rund ums energiesparende Bauen und Sanieren: von der bequemen Telefonauskunft über die kostenlose Kurzberatung in einer Energieberatungsstelle in Ihrer Nähe bis hin zur umfangreichen Vor-Ort-Beratung bei Ihnen Zuhause.